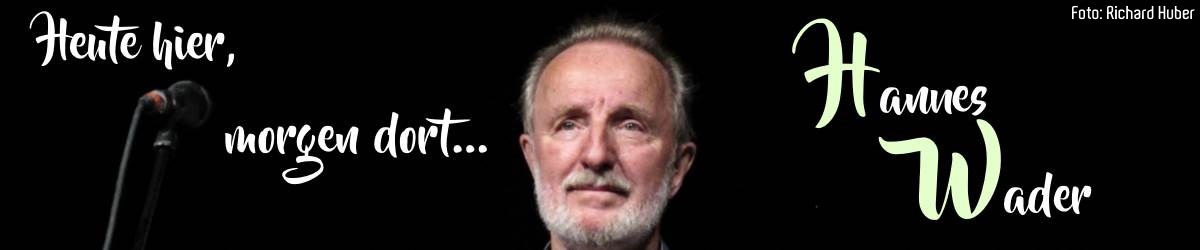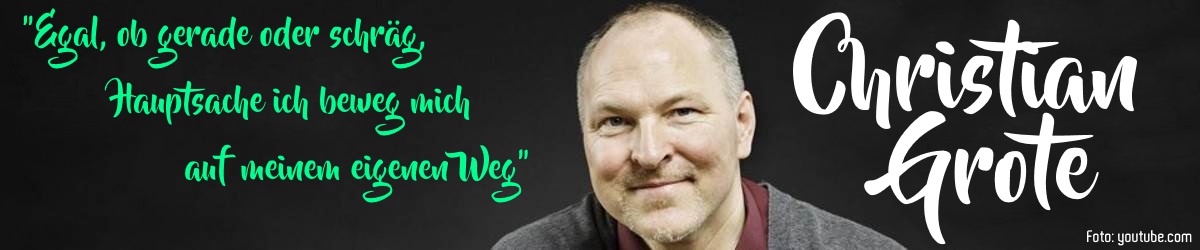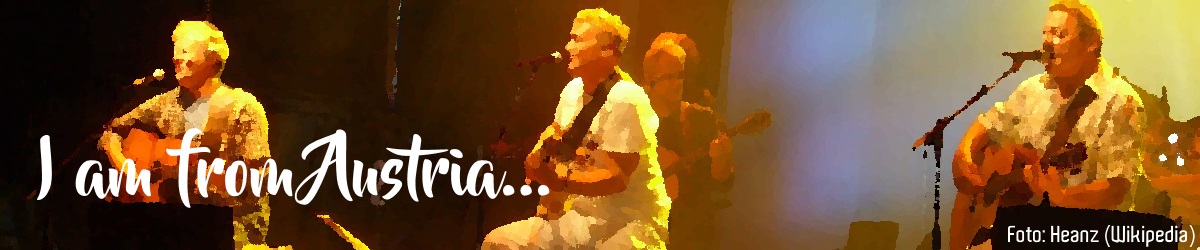Was hat es mit dem Projekt "Jeden Tag ein neues Lied" auf sich?
Am 01.01.2023 habe ich mit das Projekt Jeden Tag ein neues Lied gestartet mit dem Vorsatz, ein Jahr lang jeden Tag ein anderes Lied von Reinhard Mey zum Thema zu machen und aus einer eigenen Perspektive zu beleuchten.
Das Prinzip ist simpel und bereits im Namen wird erklärt, was genau ich damit meine: ich werde jeden Tag in diesem Forum ein Lied des Tages posten und in Form eines Videos in den Beitrag einbauen. Die Idee dahinter ist, mich selbst mit den Liedern auseinanderzusetzen, meine Einstellung bzw. meine "Beziehung" zum jeweiligen Lied zu beschreiben UND gleichzeitig alle dazu einladen, die eigene "Geschichte zum Lied" mit den anderen Besuchern des Forums zu teilen.
Zu jedem Lied starte ich zudem eine Umfrage, die je nach Situation einen Tag oder eine Woche laufen soll und bei der alle kurz und knackig ihre Einstellung zum Lied abgeben können, ohne einen eigenen Beitrag dazu schreiben zu müssen - obwohl das natürlich auch erwünscht und geboten ist, schließlich ist das hier ein Forum
Das Prinzip ist simpel und bereits im Namen wird erklärt, was genau ich damit meine: ich werde jeden Tag in diesem Forum ein Lied des Tages posten und in Form eines Videos in den Beitrag einbauen. Die Idee dahinter ist, mich selbst mit den Liedern auseinanderzusetzen, meine Einstellung bzw. meine "Beziehung" zum jeweiligen Lied zu beschreiben UND gleichzeitig alle dazu einladen, die eigene "Geschichte zum Lied" mit den anderen Besuchern des Forums zu teilen.
Zu jedem Lied starte ich zudem eine Umfrage, die je nach Situation einen Tag oder eine Woche laufen soll und bei der alle kurz und knackig ihre Einstellung zum Lied abgeben können, ohne einen eigenen Beitrag dazu schreiben zu müssen - obwohl das natürlich auch erwünscht und geboten ist, schließlich ist das hier ein Forum
Das "Lied" Cantus 19 B ist wohl eher ein instrumentalisiertes Gedicht (was nicht schlecht sein muss) und beschreibt die Unsicherheit und Veränderlichkeit des Seins und das Streben nach Unendlichkeit und Unerschaubarem. Mehr kann ich dem nicht entnehmen und mehr Worte sollten darüber wahrscheinlich auch nicht verloren werden!
Aber: für das Projekt Jeden Tag ein neues Lied habe ich mir vorgenommen, jedes Lied genauer anzuschauen und mir ein paar Gedanken zu machen. Manchmal ergibt sich aus einer Situation oder einem besonderen Erlebnis die Gelegenheit, sich mit einem Lied auseinanderzusetzen. So ist es mir bei diesem Song gegangen. Ich habe bei einem längeren Spaziergang im frühlingshaften Sturmwetter einen Podcast über Zaubersprüche und Verschwörungsformeln die sich reimen gehört und bin dabei auf das Lied gekommen. Mal schauen, was ich aus den knapp 70 Worten raushole
Hauptsache, es reimt sich!
Am 17.01.2023 habe ich den BR-RadioWissen-Podcast Magie des Reims von Zaubersprüchen und Gedichten gehört und dabei ist mir dieser Cantus 19 B von Reinhard Mey eingefallen. Wer also verstehen möchte, warum ich dieses Lied mit dem Podcast in Verbindung bringe, sollte sich die ca. 20 Minuten Zeit nehmen, um sich diese Sendung anzuhören.
Der Beitrag von Brigitte Kohn ist schon im Jahr 2013 produziert worden und wird auf der Webseite der Sendung mit diesen Worten eingeleitet:
Ich persönlich mag Lieder auch besonders, wenn sie sich reimen und es fällt einem viel leichter, einen Text zu behalten, wenn er sich reimt. Die ganze Sache mit den Versmaßen, den Reimschemata oder auch den betonten oder unbetonten Silben war mir sonst immer zu kompliziert und deshalb habe ich da nie aufgepasst. Die ersten gereimten Sprüche, an die ich mich aus der Kinderzeit erinnern kann sind z.B. "eins zwei drei vier fünft sechs sieben ... eine alte Frau kocht Rüben ... eine alte Frau kocht Speck ... und Du bist weg" und noch ein paar andere Zählreime.Beschreibung der Sendung auf der BR-Podcast-Seite hat geschrieben:Sprache macht Spaß, gereimte ganz besonders. Wer reimt, der kostet Ton und Klang der Sprache aus, der spürt der geheimnisvollen Verwandtschaft nach, die zwischen ähnlich lautenden Wörtern walten mögen. Seit alters her haben sich die Menschen viele Möglichkeiten einfallen lassen, den Gleichklang der Wörter auszukosten. (BR 2013)
Hauptsache Metapher!
In dem Text verwendet Mey Metaphern wie "Seiendes Nichtsein", "Fließendes Blau", "Flügellos gleichsam entschwebend" und "Lodernd im Werden die Sinne entlang". Es wird auch das Bild des "Ehernen Zugriffs" und die Vorstellung von "Endlosem Enden unendlich" und "unerschaubaren Nichts" genannt. Weiter verwendet er auch die Metaphern "Bleibend der Leere allheilige Kraft" und "Seliges nimmer erahnend".
Wer sich jetzt fragt, was das eigentlich alles bedeuten soll: Alles und Nichts! Je nachdem, wie bereit man ist, sich auf solche Texte einzulassen - ich habe das jetzt mal versucht, als ich mich dazu entschieden habe, mich mit dem Cantus 19 B zu beschäftigen
Was interpretiert eine "künstliche Intelligenz" in den sinnfreien Text von Mey aus dem Jahr 1974?
| Metapher_im_Text | Interpretation von chatGPT |
|---|---|
| Seiendes Nichtsein | ... beschreibt das Paradoxon, dass etwas, das existiert, gleichzeitig auch nicht existiert oder unsichtbar bleibt. Es kann auch als eine Art spirituelle oder existentielle Erfahrung interpretiert werden, in der die Grenze zwischen Existenz und Nichtexistenz verwischt wird und die Vorstellung von Realität infrage gestellt wird |
| flügellos gleichsam schwebend | ... beschreibt einen Zustand, in dem etwas ohne die Hilfe von Flügeln oder einer anderen Hilfe scheinbar schwebend und unbeweglich ist. Es beschreibt einen Zustand der Unsicherheit oder Unbestimmtheit |
| fließendes Blau | ... könnte eine metaphorische Beschreibung von etwas Unbeständigem oder Veränderlichem sein, das sich bewegt oder regt, oder es könnte sich auf eine visuelle Vorstellung von fließendem Wasser oder einer blauen Farbe beziehen. Es ist schwer, eine exakte Bedeutung zu bestimmen, ohne mehr Kontext |
| lodernd im Werden die Sinne entlang | ... beschreibt einen Prozess des Veränderns und Entwickelns, bei dem die Sinne (also die Wahrnehmungs- und Empfindungsfähigkeiten) eine Rolle spielen. Es könnte sich darauf beziehen, dass die Wahrnehmung des Betrachters sich im Laufe des Prozesses verändert und stärker "brennt" oder "lodert". Es könnte auch beschreiben, dass die Sinne aktiv an dem Prozess des Werdens beteiligt sind. Die genaue Bedeutung hängt jedoch von dem Kontext des Gesamttextes ab und kann nur anhand dessen vollständig interpretiert werden |
| Stets ans Gewordene mahnend | ... bedeutet, dass etwas immer daran erinnert wird, was bereits geworden ist. Es gibt eine Verbindung zu dem, was bereits existiert und es wird daran erinnert, dass es nicht vergessen werden sollte. Dies kann sich auf die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft beziehen und kann sowohl positive als auch negative Aspekte haben. In diesem Kontext des Gedichts kann es sich auf die Schönheit und Unbeständigkeit des Lebens beziehen |
| endlosem Enden unendlich | ...beschreibt eine Idee, dass das Ende unendlich ist, es gibt kein endgültiges Ende. Es impliziert, dass alles in einem fortlaufenden Zyklus des Werdens und Vergehens ist, und dass das Ende nur ein weiterer Schritt in diesem Prozess ist. Es könnte auch die Idee des Unendlichen oder des Ewigen in Bezug auf das Leben oder das Universum vermitteln |
| bleibend der Leere allheilige Kraft | ... schwierig, eine präzise Interpretation dieser Metapher zu geben, da der Kontext fehlt und der Text insgesamt sehr abstrakt und poetisch ... scheint ... auf eine Art von existentiellem oder spirituellem Konzept zu verweisen, das die Idee einer bleibenden, heiligen Kraft innerhalb der Leere oder des Nichts beinhaltet ... könnte sich auf die Idee beziehen, dass inmitten der Leere oder des Nichts, das in der Existenz oft als etwas Negatives angesehen wird, etwas Heiliges oder Wertvolles zu finden ist |
Naja, und weil ich nun schon dabei war, habe ich mir auch die anderen Podcasts, die passend zum Thema unter RadioWissen abrufbar sind, angehört und möchte sie allen empfehlen:Beschreibung der Sendung auf den BR Seiten hat geschrieben:Metaphern begleiten uns täglich. Sie ermöglichen uns, abstrakte Sachverhalte bildhaft anschaulich zu machen. Mit diesem Wort-Werkzeug beeinflussen wir unser Gegenüber oft unbewusst. Ein Blick in die Gebrauchsanleitung lohnt sich. (BR 2018)
- Wenn Sprache zur Musik wird - Von Lautmalerei und Rhythmus
Text zur Sendung: Rascheln, rauschen, rattern. Lautmalereien. Bekannt aus Comics und Sprechblasen sind sie auch in der Literatur seit jeher beliebt. Nachzulesen u.a. bei Joachim Ringelnatz, Ernst Schwitters, Ernst Jandl und dem slammer Frank Klötgen. - Die deutsche Sprache - Deutsch und seine lange Geschichte
Text zur Sendung: Deutschland ist das einzige europäische Land, in dem sich die Bevölkerung nach der Sprache betitelt hat und nicht nach dem Land. Deswegen ist die Geschichte der Deutschen Sprache auch immer eine Geschichte Deutschlands. Doch die Frage "wie" und "was" gesprochen wird, war aber auch immer ein Politikum. - Die Macht des Wortes - Segen, Fluch und Wortmagie
Text zur Sendung: Die Geschichte der Worte ist eine der Ermächtigung - denn sie kommen von Gott oder den Göttern. In allen Kulturen hat man so von jeher versucht, mit Zaubersprüchen, Flüchen oder Segen, die Welt und das Schicksal zu beeinflussen. Auf dem Glauben, dass bestimmte Wörter magische Kraft besitzen, fußt die Macht des Wortes - Literatur des Mittelalters - Zaubersprüche und Minnesang
Text zur Sendung: Minnesang und Zaubersprüche, Vagantenlied und Spruchdichtung. Hohes Lied, Heldenepos und Fürstenlob. Welche Literaturformen erdichteten, zitierten, sangen und trugen Menschen im Mittelalter vor?
Es ist kein Zufall, dass sich Zaubersprüche und Verschwörungen reimen, für mich war das schon immer ein "ungeschriebenes Gesetz" und ich hatte mir darüber noch nie wirklich Gedanken gemacht (vermute ich, zumindest ist es mir heute nicht mehr bewusst). In dem Podcast von Brigitte Rohn wird sich dieser Tatsache auch angenommen und die These, dass gereimte Texte häufig auch deshalb gereimt waren, um sie länger zu bewahren, in einer Zeit, in der die geschriebene Sprache noch nicht üblich war, ist für mich gut nachvollziehbar.
Der Text von Cantus 19 B hört sich auch ein wenig wie eine "Formel" an, mit der irgendetwas "heraufbeschoren" werden soll. Das ist sicher auch eine Absicht dahinter, freilich, ohne dass eine sinnvolle Aussage dahinter steckt!
Parodie der Dichter und Intellektuellen
Das Lied Cantus 19 B ist für mich aber ganz eindeutig vor allem eine parodistische Antwort auf diejenigen Künstler und "intellektuellen" Kritiker von Meys Liedern aus den Anfangsjahren seiner Karriere, die ihm vorwarfen, mit seinen einfach gestrickten und leicht verständlichen Texten, die sich zudem auch noch reimten, nicht mehr dem Zeitgeist zu entsprechen. Wieder so eine "Revolutionsgeschichte", bei der Mey wohl nicht mitmachen wollte
Das gefiel - und gefällt nach wie vor - nicht allen Menschen, die für sich scheinbar in Anspruch nehmen, entscheiden zu können/dürfen, was richtig gute Texte ausmachen. Z.B. schrieb der Schriftstelle Michael Ebmeyer in einem Beitrag auf ZEITonline unter dem Titel Der bashende Barde zu Cantus 19 B folgendes:Im Eintrag zum Album "Ich bin aus jenem Holze" hat geschrieben:Das Lied Cantus 19b macht sich mit einem Nonsenstext lustig über bestimmte moderne Lyrik-Strömungen, die Quantität über Qualität stellen
Auf Zwei Hühner auf dem Weg nach vorgestern freue ich mich auch schon ...aber das kommt auch noch dran... und, dass Michael Ebmeyer diese beiden Lieder in einem Absatz unterbringt und somit aus meiner Sicht "zusammenbringt", finde ich zwar unpassend, aber das nur am Rande. Der interessante Teil an diesem Beitrag von 2020, über den wir hier auf dem Forum uns ja auch intensiv ausgetauscht haben in der Diskussion (zeit.de) Michael Ebmeyer - Der bashende BardeAuszug aus dem ZEIT-Beitrag "Der bashende Barde" hat geschrieben:Weniger anklagend, dafür besonders ranzig gerät dem Chansonnier in seiner mittleren Schaffensperiode der Spott über die ach so abgehobenen Kunstschaffenden. Erschöpfte sich sein erster Vorstoß in die Richtung, Cantus 19b aus dem Jahr 1971, noch im kurzen und fast schmerzlosen Scheitern an einer Persiflage moderner Lyrik, so fiel seine Parodie auf das experimentelle Theater in Zwei Hühner auf dem Weg nach vorgestern drei Jahre später erfreulich komisch aus.
Dass es Reinhard Mey letztlich zu mühsam und zu nervig ist, sich wirklich detailliert mit dieser Kritik und der Modeerscheinung ungereimter Gedichte zu beschäftigen, zeigt die Länge seines Beitrags zu diesem Thema: 67 Wörter! Es gibt nur noch zwei weitere Lieder in seinem Portfolio, welche unter 2 Minuten lang sind, nämlich Alles was ich habe, bringt es auf 301 Wörter und auch in dritten Lied (...und Tschüss), bringt er ganze 206 Wörter unter
Kommentare des Künstlers und Erwähnung des Lieds in anderen Quellen
Zu diesem Lied hat sich Mey meines Wissens nach nie geäußert. Sollte es dazu Interviews von der Zeit vor dem Internet geben und jemand kann meine Behauptung widerlegen, bin ich nicht beleidigt
Interessant finde ich es, dass gerade dieses Lied auf dem 1973er 2-LP-Sampler Musik und Zeitgeschichte - 1948 bis 1973 des Magazins Stern neben Aufnahmen wie "Richard Nixon Am Mondtelefon", "Heintje - Ich Sing Ein Lied Für Dich", "Willy Brandt: Wir Wollen Mehr Demokratie Wagen", "Franz Josef Strauß: Deutschland Braucht Bayern" oder auch "Spiel mir das Lied vom Tod" und "Heino - Blau blüht der Enzian" als eine zeitgeschichtliche Aufnahme vereweigt wurde
Und was gibt es noch zu sagen?
Das Lied (Gedicht) besteht aus einer einzige Strophe und enthält insgesamt 11 Zeilen, die in einem ungebundenen Versmaß geschrieben wurden. In diesem Fall hat sich Reinhard Mey sicher bewusst diesem Stilmittel bedient, um sein Gedicht nur ja nicht allzu gefällig werden zu lassen. Das Reimschema ist als Blockreim umgesetzt also abbacddc... und zum Abschluss verwendet er einen Schlagreim mit "Druck ... ruckzuck"
Da es sich nicht wirklich um ein Lied im eigentlichen (meyschen) Sinne handelt, gibt es auch nicht wirklich eine Melodie, eher wird das Gedicht vertont und durch den Künstler in einem relativ gleichförmigen Singsang heruntergeleiert. Nicht wirklich für das Radio geeignet. Allerdings finde ich die Violinen sehr stimmungsvoll. Vielleicht war das der Grund, warum dieses Lied nie als Single ausgekoppelt wurdeBeispiel für das Reimschema "Blockreim" hat geschrieben:Seiendes Nichtsein verschleiert mich bang
Fließendes Blau regt sich bebend
Flügellos gleichsam entschwebend
Lodernd im Werden die Sinne entlang
Bleibend allein ist des fließenden Lichts
Eherner Zugriff beständig
Endlosem Enden unendlich
Näher noch dem unerschaubaren Nichts
Meine Meinung zum Lied des Tages
Meine Wertung:
Cantus 19 B ist als Lied Nr. 4 auf dem Album Ich bin aus jenem Holze veröffentlicht und stellt das bisher kürzeste Lied in der Karriere des Liedermachers dar (ähnlich kurz wie ...und Tschüss auf Immer weiter, aber immer noch 29 Sekunden kürzer!)
Ich bin aus jenem Holze ist das vierte deutsche Studioalbum von Reinhard Mey, es erschien 1971 bei Intercord und enthält insgesamt 12 Titel mit einer Gesamtlänge von 43:15 Minuten. Das Album stieg im Jahr der Veröffentlichung bis auf Platz 8 der deutschen Charts auf und erreichte insgesamt Gold-Status bei den Verkäufen.
Diese und weiter Informationen zum Album habe ich auf discogs.com und auf Wikipedia gefunden.
Titelliste und Cover des Albums "Ich bin aus jenem Holze"
- Das Geheimnis Im Hefeteig Oder Der Schuß Im Backofen - 5:27
- Längst Geschlossen Sind Die Läden - 2:31
- Der Mörder Ist Immer Der Gärtner - 4:51
- Cantus 19b - 1:13
- Ich Glaube, So Ist Sie - 4:08
- 71 1/2 - 3:24
- Ich Bin Aus Jenem Holze Geschnitzt - 3:13
- Der Irrende Narr - 3:29
- Ich Trag' Den Staub Von Deinen Straßen - 5:12
- Maskerade - 3:19
- Seifenblasen - 2:45
- Sie Ist Zu Mir Zurückgekommen - 3:15